Die vergleichende Musikwissenschaft beschäftigte sich mit der Musik aus unterschiedlichen Kulturen der Welt. Dabei erforscht sie die klanglichen, kulturellen und sozialen Aspekte von Musik. Wie sie entstanden ist und welche Ideen und Methoden ihr zugrunde liegen, erklären wir Ihnen in diesem Artikel.
Was waren die Anfänge der vergleichenden Musikwissenschaft?
Die Grundidee der vergleichenden Musikwissenschaft geht auf Guido Adler (1855–1941) aus Wien zurück. Adler definierte sie als eine von vier Untergruppen der Musikwissenschaft:
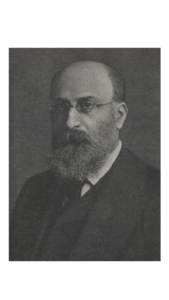
Der österreichische Musikwissenschaftler Guido Adler. Quelle: Autor’in unbekannt – ÖNB, Bildarchiv Austria, Inventarnummer Pf 4329: B (2), Gemeinfrei
[Ziel ist es,] die Tonerzeugnisse, insbesondere die Volkslieder verschiedener Völker, Länder und Gegenden, in ethnografischer Absicht zu vergleichen, sie nach der Mannigfaltigkeit ihrer Eigenschaften zu gruppieren und zu ordnen.
(Frei nach Adler)
Um die Musik verschiedener Kulturen besser verstehen zu können, flossen unterschiedliche Methoden aus der Biologie und der Geografie in die vergleichende Musikwissenschaft ein. Besonders einflussreiche Methoden waren dabei die Erforschung der Erdgeschichte anhand von Gesteinsschichten und die Klassifizierung von Pflanzen und Tieren in der Biologie. Zusätzlich prägten vergleichende Methoden der anatomischen Forschung und die Evolutionstheorie von Darwin die intellektuelle Grundlage dieser Forschungsart. So versuchten die Forscher’innen mit den Methoden dieser Wissenschaften die Musiken der Welt zu vergleichen und zu neuen Erkenntnissen ihrer Geschichte zu kommen.
Erste Forschungen durch neue Technik
Schon immer spielten Technologien eine entscheidende Rolle bei der Erforschung unterschiedlicher Musikkulturen. Die frühe vergleichende Musikwissenschaft bediente sich des Edison-Phonographen für die Musikaufzeichnung. Mittels Frequenzanalyse wurden Tonsysteme unterschiedlicher Musikkulturen verglichen. So konnte Alexander J. Ellis (1814–1890) mit der Entwicklung seiner Cent-Skala (1885) zeigen, dass die in der Musik verwendeten Tonskalen keinen „Naturgesetzen“ unterlagen. Bis zu diesem Zeitpunkt war die Idee eines „Naturgesetzes“ bei musikalischen Skalen die verbreitete Annahme in der westlichen Kultur gewesen. Anhand des Berliner Phonogramm-Archivs konnten Carl Stumpf (1848–1936) und Erich Moritz von Hornbostel (1877–1935) grundlegende Fragen der Psychoakustik beantworten und neue Methoden zur Analyse von Tonleitern und Melodien entwickelt. Prägend ist auch die Klassifizierung der Musikinstrumente von Hornbostel und Sachs, welche bis heute eine gängige Musikinstrumentensystematik ist. Unser Institut nutzt Laser-Messungen eine Hochgeschwindigkeitskamera und künstliche Intelligenz (KI), um die Musik verschiedener Kulturen zu verstehen und zu vergleichen.
Verschiedene Strömungen der vergleichenden Musikwissenschaft
Neben den zuvor genannten Personen beeinflussten deutsche Anthropolog’innen am Anfang des letzten Jahrhunderts die vergleichende Musikwissenschaft. Dabei entwickelten sie die sogenannte „Kulturkreistheorie“. Die Annahme war hier, dass sich verschiedene kulturelle Gruppierungen in geografische Regionen unterteilen ließen. Im Sinne der darwinistischen Evolutionstheorie sollten sich die Gruppen in eine chronologische Reihenfolge ihrer Entwicklung bringen lassen. Dabei nahmen die Forscher’innen an, dass die am weitesten verbreiteten musikalischen Praktiken am ältesten seien. Kulturelle Praktiken mit einer kleinen geografischen Verbreitung sollten erst in der jüngeren Zeitgeschichte aufgetreten sein. Curt Sachs (1881–1959) vertrat auf dieser Grundlage, dass Rasseln ein besonders altes Instrument seien, wohingegen das Xylophon ein jüngeres Instrument wären. In der heutigen Zeit wird die Kulturkreislehre von Wissenschaftler’innen nicht mehr vertreten. Dies hat zur Ursache, dass die Theorie auch einen wertenden Charakter bezüglich der Entwicklungsstufe unterschiedlicher Kulturen beinhaltet. So wurde die Kulturkreislehre auch insbesondere zur Zeit des Nationalsozialismus vertreten.
Musikethnologische Forschung fand bis zur Mitte des letzten Jahrhunderts jedoch nicht ausschließlich im Rahmen darwinistischer Ansätze oder der Kulturkreistheorie statt. So sammelten Forscher’innen wie J.W. Fewkes (1850–1930), Frances Densmore (1867–1957) und Helen Roberts (1888–1985) Musik der indigenen Völker in Nordamerika vor einem anderen Forschungshintergrund. Als dritte Strömung vor 1950 traten Wissenschaftler auf, welche innereuropäische Volksmusik erforschten.
Die vergleichende Musikwissenschaft ab 1950
Ab den 1950er Jahren nahmen die europäischen Musikwissenschaftler’innen Abstand von evolutionären Kulturtheorien. Vermehrt wurden nun lokale Studien betrieben, welche die Musik als Teil der Kultur verstanden. Neue Methoden waren jetzt nicht mehr der Vergleich von Kulturen, sondern mehr quantitative Analysemethoden. Dabei kamen viele Ansätze aus den Sozialwissenschaften und anderen systematischen Wissenschaften zum Tragen. So wandelte sich in der Nachkriegszeit auch die Begriffsbezeichnung von der vergleichenden Musikwissenschaft zur Musikethnologie.
Weitere Artikel zur Musikethnologie können sie auch auf unserem Blog finden, und durch die KI-geführte musikethnographische Sammlung der Universität Hamburg stöbern.
Literatur zur vergleichende Musikwissenschaft
Bader, R. (2019) (Hrsg.): Computational Phonogram Archiving, Springer: Cham https://doi.org/10.1007/978-3-030-02695-0
Bader, R. (2018). „Music Ethnology“, in: R. Bader (Hrsg.): Springer Handbook of Systematic Musicology, Springer: Berlin, Heidelberg https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-662-55004-5?page=3#toc
Rice, T. (2001), „Comparative musicology“, in: Grove Music Online, Oxford University Press https://doi.org/10.1093/gmo/9781561592630.article.46454
